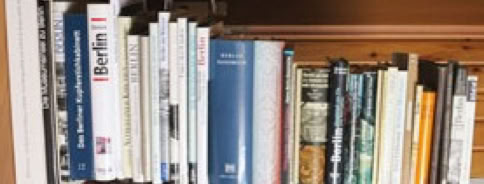Staatliche Museen zu Berlin - Museumsinsel und Dom
Pergamonmuseum
An diesen freien Anblick auf diese Fassade der Antikensammlung muss demnächst verzichtet werden.
Traurig, aber wahr: Das Pergamonmuseum schließt am 28. September 2014 für 5 Jahre. Jetzt, 2021, rechnet man schon bis 2025 - wenn das man reicht.
Der Masterplan für die Museumsinsel sieht bis 2025 eine Investition von 1,5 Milliarden Euro vor.
Rund ein Drittel sind für das Pergamonmuseum vorgesehen. Seit der Eröffnung des Museums 1930 wurde nicht mehr viel für das Haus getan.
Alle 5 Museen werden über unterirdische Gänge verbunden und erhalten einen zentralen Eingang, die James-Simon-Galerie, die seitlich ans Pergamonmuseum heranreicht.
Der Pergamonaltar hat 2013 1, 26 Millionen Besucher angezogen.
Gar nicht so einfach am Pergamonmuseum keinen Kran auf das Bild zu bekommen (März 2014).
Die Fassaden und die Sparsamkeit
Zu Baubeginn des Pergamonmus im Jahre 1910 war schon das Geld knapp. Der 1. Weltkrieg, die Novemberrevolution von 1918 und die Inflation erlaubten die Eröffnung erst 1930. Es musste also immer gespart werden.
Zu sehen an den Fassaden. Ist die Schmuckfassade zum Kupfergraben hin noch sehr aufwendig gestaltet worden, mussten an den anderen Außenmauern gespart werden.
Die Nordfassade zum Bodemuseum, die im Westen zur Spree hin und die südliche im Innenhof zum Neuen Museum ist der Putz mit Granulat aus Naturstein versetzt. Das es gut aussieht, wurden Fugen eingefügt, wie sie Steinmetzearbeiten zeigen.
In der Hauptfassade dagegen sind ganze Erdzeitalter verbaut: fränkischer Muschelkalk aus dem Perm, sächsischer und kroatischer Bale-Kalkstein aus der Kreidezeit. Das alles in massiven Natursteinplatten und echter steinmetzweise bearbeitet.
Jetzt wird die Dreiflügelanlage um den von Anfang an geplanten vierten Flugel ergänzt. Aus Beton und Glas natürlich und nicht mit Steinen aus dem Perm. Kann das keiner mehr?
Links die runde Kuppel des Bode-Museums, Stadtbahntrasse, dann, komplett eingerüstet der Flügel für islamische Kunst, der Ehrenhof und, in der Mitte des Bildes, die Vorderasiatische Sammlung.
Der Ehrenhof wird mit einem 4. Flügel zum Kupfergraben hin abgeschlossen wie auf dem Baustellenschild zu sehen ist.
Der Saal mit dem weltberühmten Pergamonaltar ist bis 2019 geschlossen
Der Pergamonaltar wurde
unter König Eumenes II. im 2
Jhdt. v. Chr. in Kleinasien auf
dem Tempelberg der Stadt
Pergamon errichtet.
Alleine die Freitreppe maß 20 m, die Breite ist 35 m und die Tiefe 33 m.
Auf den Sockeln sind
Hochreliefs angebracht. Sie
stellen den Kampf griechischer
Götter gegen die Giganten dar
.
Die türkische Regierung
erlaubte die von dem
deutschen Ingenieur Carl
Humann von 1878 bis 1886
ausgegrabenen Teile der
Friese nach Berlin auszuführen.
Hier wurden die in tausende Stücke zerstörten Platten von italienischen Restaurateuren wieder zusammengesetzt.
Um den Altar ausstellen zu
können, wurde von 1901 bis
1908 ein erstes Pergamonmuseum gebaut.
1930 wurde dieses durch das
Pergamonmuseum ersetzt -
ziemlich genau 100 Jahre nach
Schinkels Neuen Museum
gleich um die Ecke (heute
Altes Museum).
Schwere Zerstörungen erlitt das Museum im 2. Weltkrieg, noch schwerere durch die Rote Armee. Was noch im Haus war, wurde nach Moskau und Leningrad geschleppt.
Teile davon bekam die DDR 1958/59 zwar wieder zurück, aber wesentliche Stücke befinden sich immer noch in den Depots der
Eremitage in St. Petersburg oder in Moskau im Puschkin-Museum.
Das ist völkerrechtswidrig. Zwar haben die Bundesrepublik Deutschland und Russland 1990 die Rückgabe vereinbart, aber das Russische Parlament zusammen mit den Moskauer Musemsdirektoren meinen, die Kriegsbeute gehöre für immer dem russischen Volk: es geht um den sagenhaften Goldschatz des Priamos (richtig: Schatz - oder Gold - von Troja, denn König Priamos passt zeitlich nicht zu dem Fund).
Heinrich Schliemann fand ihn bei Ausgrabungen am 31. Mai 1871 an der Stadtmauer von Troja. Der Schatz umfasst 8000 Stücke. Schliemann verschwieg den Fund vor osmanischen Behörden und brachte ihn
heimlich außer Landes.
Nachdem er den Fund Paris, St. Petersburg und London vergebens zum Kauf angeboten hatte, schenkte er 1881 alles dem Deutschen Volk. Kaiser Wilhelm I. ernannte ihn zum Ehrenbürger von Berlin und stellte das Gold auf der Museumsinsel aus.
Markttor von Milet
Markttor von Milet
Ischtar-Tor von Babylon aus der Zeit von Nebukadnezar II. 605-562 v. Chr.
Löwen sind das Symbol der Göttin Ischtar
Verschiedene Tierskulpturen in der Prozessionsstraße von Babylon
Ansichten aus der Blumenstraße von Babylon
Statue des römischen Kaisers Trayan
Statue der Athena Parthenos
August 2016
Der Ehrenhof am 7. August 2016. Wollte ja bei Frau Merkel klingeln, aber die beiden Polizisten hatten was dagegen. Die Bundeskanzlerin wohnt hier genau gegenüber der Einfahrt. Was hat Berlin gelacht, als bekannt wurde, dass die Überwachungskamera des Eingangs zum Pergamonmuseum in ihre Gemächer schauen konnten!
Dezember 2015
Gegenüber der Brücke in der Bildmitte wohnt Frau Merkel - nur keine Nahaufnahme!
Na klar! Berlin eben…
Ende Oktober 2016. Das in Berlin die 216 Millionen für den ersten Bauabschnitt nicht reichen, wußte jeder. Nur die Planer nicht. Jetzt ist nun aber wirklich keiner Schuld, nein wirklich!
Ach, und die Baupreise sind ja so gestiegen! Und dann hat man noch ein Pumpwerk gefunden, aus der Bauzeit zwischen 1910 und 1930. Das kann doch nun wirklich keiner wissen, stand ja in keinem Plan.
Jetzt kostet dieser Bauabschnitt nur fast das doppelte: lächerliche 477 Millionen. Das konnte doch kein Planer wissen - nur jeder dahergelaufene Berliner. Der wußte das vom ersten Tag an.
Da hat die Bundesbaudirektion aber ein Ding in den Sand gesetzt. Aber den hochnäsigen, halbgöttergleichen Beamten (eigene Erfahrung!) passiert ja nichts. Bei solch einer Leistung wäre eine Gehaltskürzung um 50% durchaus angebracht.
Und die geplante Eröffnung 2019? Hahahah, reingefallen! Wer das geglaubt hat ist doof. Mitte 2023 geht doch auch, oder? Was sind schon 4 Jahre. Kann doch jedem mal passieren!
Dummerweise kommt da anschließend noch der 2. Bauabschnitt. Da soll der vierte Flügel gebaut werden. Dafür sind 134 Millionen geplant. Hey, die verscheißern uns!
Mai 2021
Baustelle Pergamonmuseum seit 2014. Eigentlich sollte alles 2024 fertig sein. Aber da wir in Berlin sind kann man getrost ein paar Jährchen dazurechnen.
Gehen Sie mal eine Seite zurück zum Bode-Museum. Die vergeben manchmal 100 kg Feingold für 5 Minuten Angst!